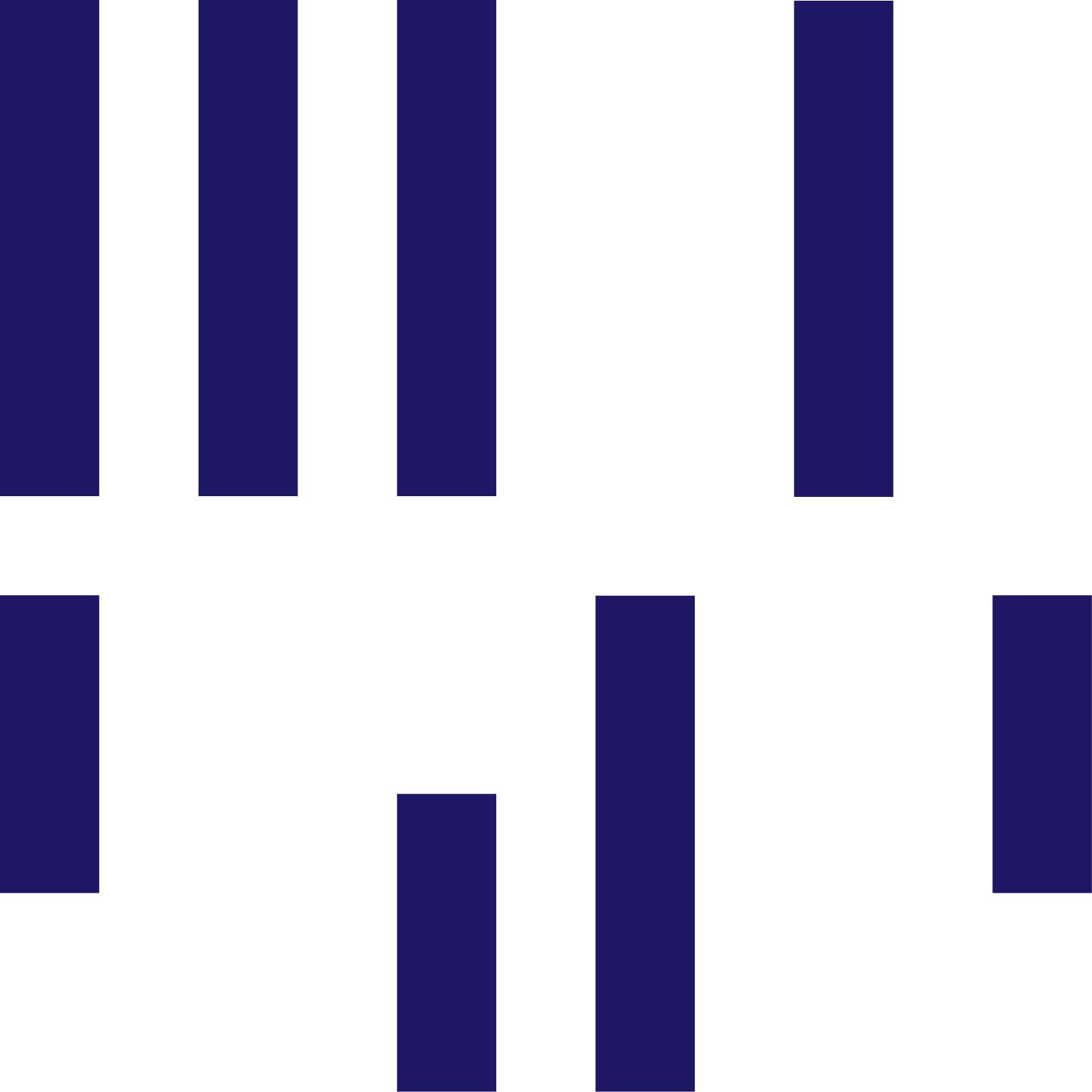Zentralbanken im Wartemodus: Wenn die Märkte das Tempo vorgeben

Zentralbanken im Wartemodus: Wenn die Märkte das Tempo vorgeben
Die globale Geldpolitik erlebt gerade ihren Herbst der Unentschlossenheit. Während die Fed nach monatelanger Pause wieder den Zinshebel bewegt, verharren ihre Kollegen in London, Frankfurt und Tokio im Beobachtermodus. Was nach koordinierter Zurückhaltung aussieht, ist in Wahrheit ein komplexes Spiel aus nationalen Zwängen, globalen Verflechtungen und der ewigen Angst vor dem falschen Timing.
An diesem Freitagnachmittag blicken wir auf eine Woche zurück, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet: Warum drückt Donald Trump den deutschen Exportüberschuss nach unten? Weshalb verkauft Japans Notenbank jetzt ETFs? Und was bedeutet es, wenn ausgerechnet die Schweizer Nationalbank zur letzten Bastion der Zinsstabilität wird?
Die Fed als einsamer Rufer in der Wüste
Die Federal Reserve hat getan, was alle erwartet hatten – und trotzdem überrascht. Die erste Zinssenkung seit Dezember kam zwar pünktlich, doch die Signale für die Zukunft bleiben nebulös. Fed-Chef Jerome Powell spricht von einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt als neuem Leitstern der Geldpolitik, während Präsident Trump bereits versucht, unbequeme Notenbankgouverneure loszuwerden.
Der neue Fed-Gouverneur Stephen Miran, erst am Dienstag vereidigt, votierte prompt für eine größere Zinssenkung um 50 Basispunkte – ein deutliches Signal, dass die politische Einflussnahme auf die vermeintlich unabhängige Notenbank zunimmt. Die Märkte preisen bis Jahresende weitere 50 Basispunkte an Senkungen ein, doch die Unsicherheit bleibt: Geht es hier noch um Inflationsbekämpfung oder bereits um Konjunkturstützung?
Besonders pikant: Während die Fed lockert, zeigen die neuesten Daten aus dem Einzelhandel eine erstaunliche Resilienz. Die US-Verbraucher geben weiter munter Geld aus, trotz – oder gerade wegen – der jahrelangen Hochzinsphase. Ein Paradoxon, das die Notenbanker in Frankfurt mit Argusaugen beobachten.
Trumps Zollkeule trifft deutsche Exporteure
Der deutsche Exportüberschuss mit den USA schmilzt wie Butter in der Sommersonne. Mit nur noch 34,6 Milliarden Euro in den ersten sieben Monaten des Jahres markiert er den niedrigsten Stand seit 2021 – ein Minus von satten 15 Prozent. Die Rechnung für Trumps Zollpolitik zahlen dabei nicht nur deutsche Unternehmen, sondern vor allem amerikanische Verbraucher.
Die Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade enthüllt ein perfides Spiel: In 77 Prozent der Fälle werden die Zollkosten entweder von ausländischen Exporteuren geschluckt oder direkt an US-Konsumenten weitergegeben. Besonders dreist agieren amerikanische Großhändler, die die Importzölle als Vorwand für zusätzliche Preiserhöhungen nutzen. Möbel verteuern sich um 3,6 Prozent mehr als die reinen Importkosten rechtfertigen würden, bei Autos und Schmuck sind es bis zu 2,3 Prozent.
Ano Kuhanathan von Allianz Trade bringt es auf den Punkt: "Die eindeutigen Verlierer im Handelskrieg sind US-Verbraucher und ausländische Exporteure." Deutsche Unternehmen müssen sich auf eine neue Realität einstellen: Der einst so lukrative US-Markt wird zum Minenfeld. Seit 1991 gab es kein Handelsdefizit mehr mit den Vereinigten Staaten – diese Serie könnte bald reißen.
Japan: Die Kunst des Nichtstuns
Die Bank of Japan hat eine Kunstform perfektioniert: das eloquente Verharren. Während die Welt auf Signale aus Tokio wartet, belässt die BoJ ihren Leitzins bei 0,5 Prozent und schiebt die Entscheidung über weitere Erhöhungen auf die Zeit nach den Wahlen.
Stattdessen überrascht sie mit einem anderen Manöver: Der angekündigte Verkauf von ETFs im Wert von jährlich 330 Milliarden Yen (etwa 2 Milliarden Euro) klingt nach viel, ist aber bei genauerer Betrachtung ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Märkte haben diese "Operation Entflechtung" längst eingepreist. Trotz der Verkäufe und moderaten Zinserhöhungen klettert der japanische Aktienmarkt munter weiter von Rekord zu Rekord.
Die wahre Botschaft aus Tokio: Stabilität geht vor Aktionismus. In einer Welt voller Unsicherheiten – von US-Zöllen bis zu geopolitischen Spannungen – wählt Japan den Weg der minimalen Intervention. Eine Strategie, die in ihrer Zurückhaltung fast schon revolutionär wirkt.
Notenbank-Roulette: Wer dreht als Nächster am Rad?
Die Schweiz wird zum Lackmustest für die globale Geldpolitik. Am kommenden Donnerstag entscheidet die SNB, ob sie bei ihrer Nullzinspolitik bleibt oder den Sprung ins negative Territorium wagt. Die Märkte tippen auf Stillstand – zu Recht. Mit einer Inflation, die sich hartnäckig im unteren Bereich des SNB-Zielbands hält, fehlt der Handlungsdruck.
Europa verharrt derweil in seiner selbstgewählten Warteposition. Die EZB sieht sich in einer "guten Position", wie Christine Lagarde nicht müde wird zu betonen. Die Märkte glauben ihr nicht ganz und preisen zaghafte 12 Basispunkte an Zinssenkungen bis Juli nächsten Jahres ein.
Kanada hingegen prescht vor: Die Bank of Canada hat ihre Zinsen auf ein Dreijahrestief gesenkt und signalisiert weitere Lockerungen. Ein mutiger Schritt angesichts der Unwägbarkeiten aus dem Nachbarland USA.
Ein System unter Stress
Was wir diese Woche erleben, ist mehr als nur geldpolitisches Taktieren. Es ist das Ringen um die richtige Balance in einer Welt, in der nationale Interessen und globale Verflechtungen zunehmend kollidieren. Die Unabhängigkeit der Notenbanken – einst sakrosankt – wird offen in Frage gestellt. Trump macht in den USA vor, was andere Populisten weltweit kopieren könnten.
Gleichzeitig zeigt sich die Fragilität des globalen Handelssystems. Deutsche Exporteure müssen sich auf eine Welt einstellen, in der Zölle zur Normalität werden. Die Gewinner sind oft nicht die, die man erwarten würde: US-Großhändler, die höhere Margen durchsetzen; japanische Aktionäre, die trotz ETF-Verkäufen profitieren; Schweizer Exporteure, die sich über einen nicht noch stärkeren Franken freuen können.
Die kommende Woche wird zeigen, ob die SNB ihrem Ruf als Überraschungskünstler gerecht wird. Der Eurojackpot mit seinen 120 Millionen Euro könnte für zusätzliche Volatilität sorgen – nicht nur beim Lottospiel, sondern auch an den Märkten, wo die Notenbanken weiterhin ihr eigenes Glücksspiel betreiben.
Eines ist sicher: Die Zeit der koordinierten Geldpolitik ist vorbei. Jede Notenbank spielt jetzt für sich – und wir alle sind die Zuschauer in diesem globalen Wirtschaftstheater.
Anzeige
Apropos Glücksspiel an den Märkten: während die Notenbanken auf Sicht fahren, gibt es in einem ganz anderen Sektor enorme Strukturgewinne, die kaum noch vom Zufall abhängen. Gemeint ist der globale Chip-Boom – eine Industrie, die nicht nur zwischen den USA und China, sondern auch hier in Europa massiv an Bedeutung gewinnt. Wer sich fragt, wie man als Anleger von diesem geopolitischen Wettlauf profitieren kann, findet eine spannende Analyse im Report "Die neue Nvidia – Ihre Chance auf bis zu +22.305 % Gewinn".
Ihnen ein erholsames Wochenende und möge Ihr persönlicher Exportüberschuss stabil bleiben.
Eduard Altmann