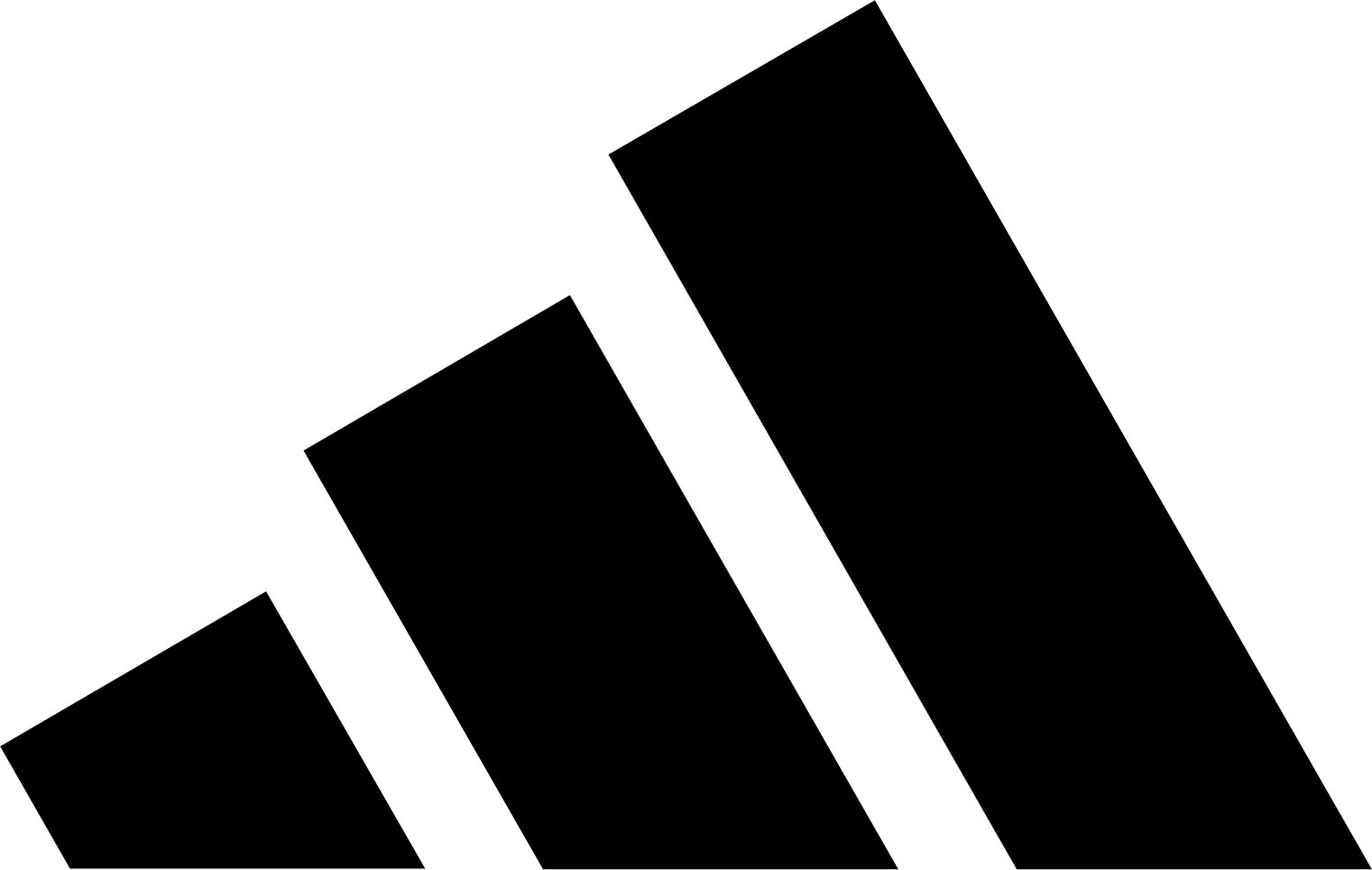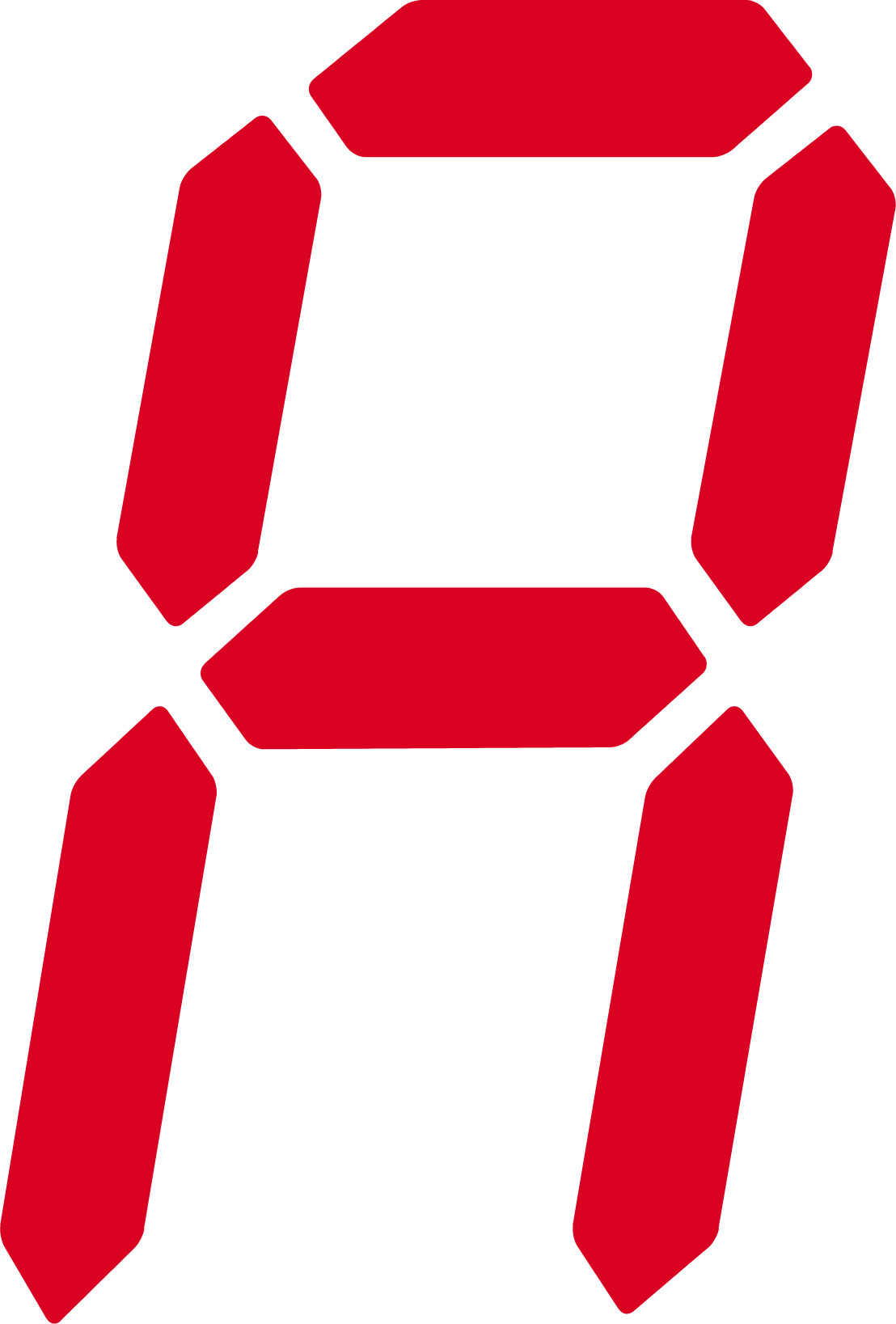Rekordhoch für globales Geldvermögen
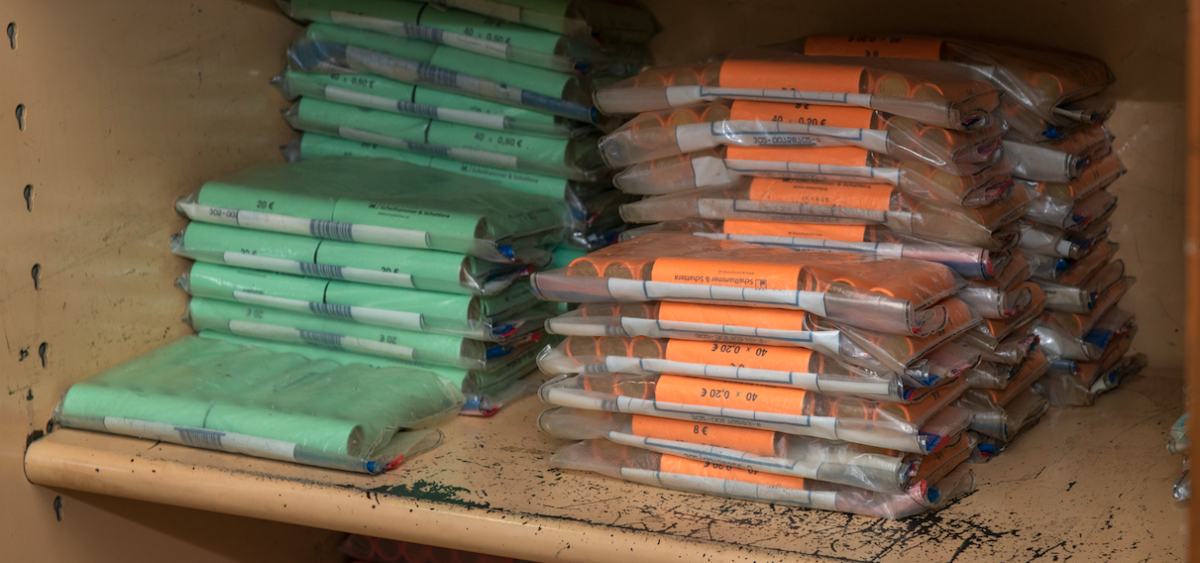
2024 war ein Rekordjahr für die Geldvermögen privater Haushalte: Mit einem Anstieg von 8,7% übertraf es sogar das starke Wachstum des Vorjahres (8,0%). Die gesamten Finanzanlagen hatten bis Ende 2024 einen Wert von EUR 269 Billionen erreicht. Gemessen an der Wirtschaftstätigkeit liegt das globale Geldvermögen mit 283% jedoch nur auf dem Niveau von 2017. Das ergab die 16. Ausgabe des „Global Wealth Report“ der Allianz, der die Vermögens- und Schuldensituation der privaten Haushalte in fast 60 Ländern analysiert.
Sparfreudige Österreicher – Versicherungsprodukte feiern Comeback
Auch inflationsbereinigt stand 2024 ein Wachstum des Geldvermögens von 2,4% zu Buche. Die Kaufkraft des Geldvermögens lag jedoch immer noch unter dem Vorkrisenniveau von 2019 (-2,5%). Dies entspricht der Entwicklung für die gesamte westeuropäische Region (-2,4%). Verbindlichkeiten gingen das zweite Jahr in Folge zurück (-0,5%). Daraus ergibt sich ein robustes Wachstum des Netto-Geldvermögens um 7,5%. Mit einem Netto-Geldvermögen pro Kopf von 75.770 Euro liegt Österreich damit auf Platz 17 der 20 reichsten Länder.
Starkes Wachstum bei Wertpapieren
Der Besitz von Wertpapieren, insbesondere von Aktien, ist für das Vermögenswachstum von entscheidender Bedeutung. In dieser Hinsicht waren die letzten zwei Jahre für Sparer äußerst erfreulich. Sowohl 2023 (11,5%) als auch 2024 (12,0%) wuchsen Wertpapiere fast doppelt so schnell wie die beiden anderen Anlageklassen: Versicherungen/Pensionen (6,7% bzw. 6,9%) und Bankeinlagen (4,7% bzw. 5,7%). Inwieweit Anleger von steigenden Wertpapierkursen profitieren, ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Portfoliostrukturen von Land zu Land und Region zu Region sehr unterschiedlich. Bemerkenswert ist, dass vor allem nordamerikanische Haushalte mit einem Portfolioanteil von 59% in Wertpapiere investiert sind. In Westeuropa und Deutschland beispielsweise liegt dieser Anteil bei etwa 35%, in Österreich etwas höher bei 43%. Auch bei der Anlage neuer Ersparnisse zeigen amerikanische Sparer eine klare Präferenz für Wertpapiere. Im Jahr 2024 machten sie 67% der neuen Ersparnisse aus, verglichen mit nur 26% in Westeuropa (Österreich: 34%).