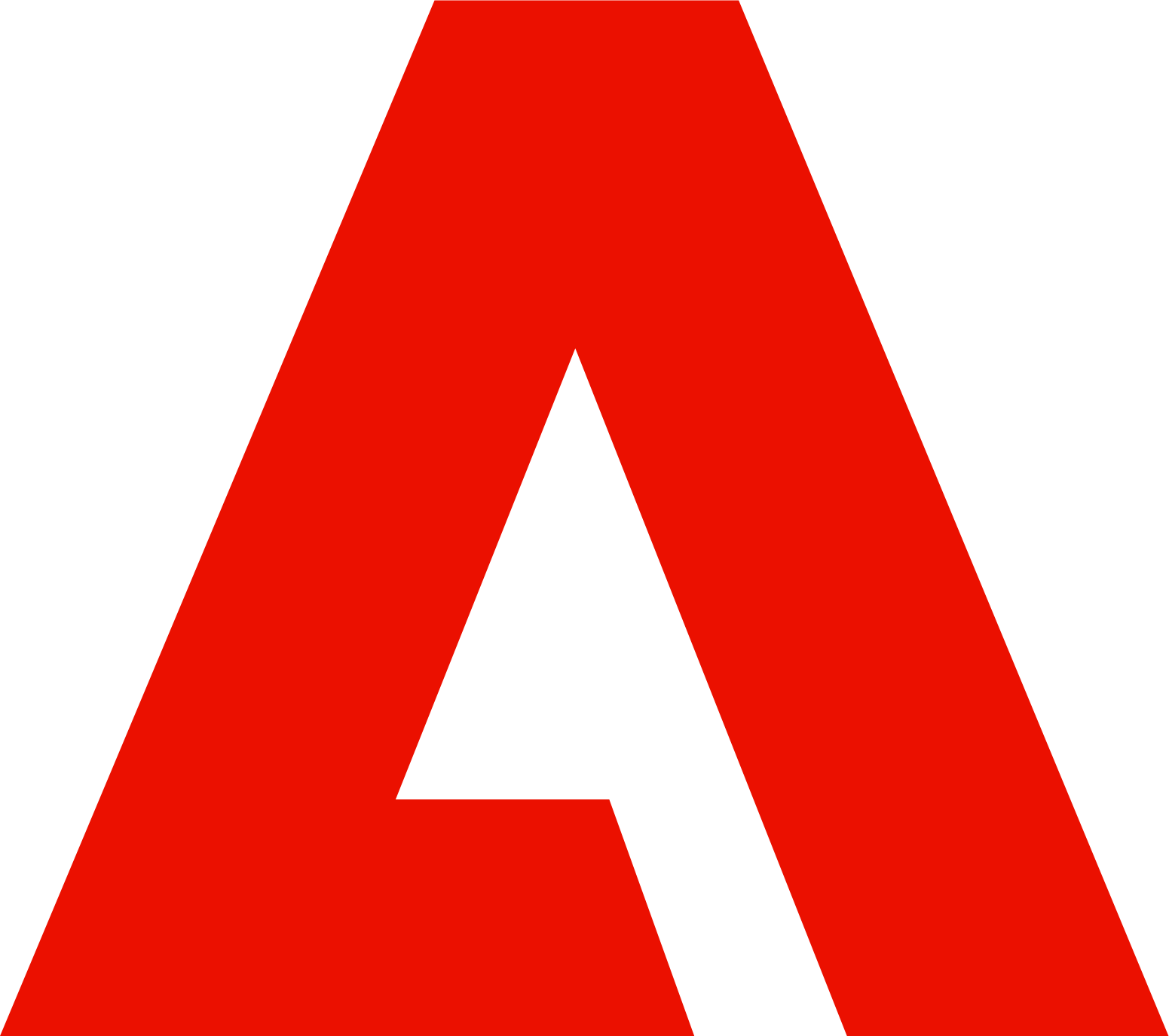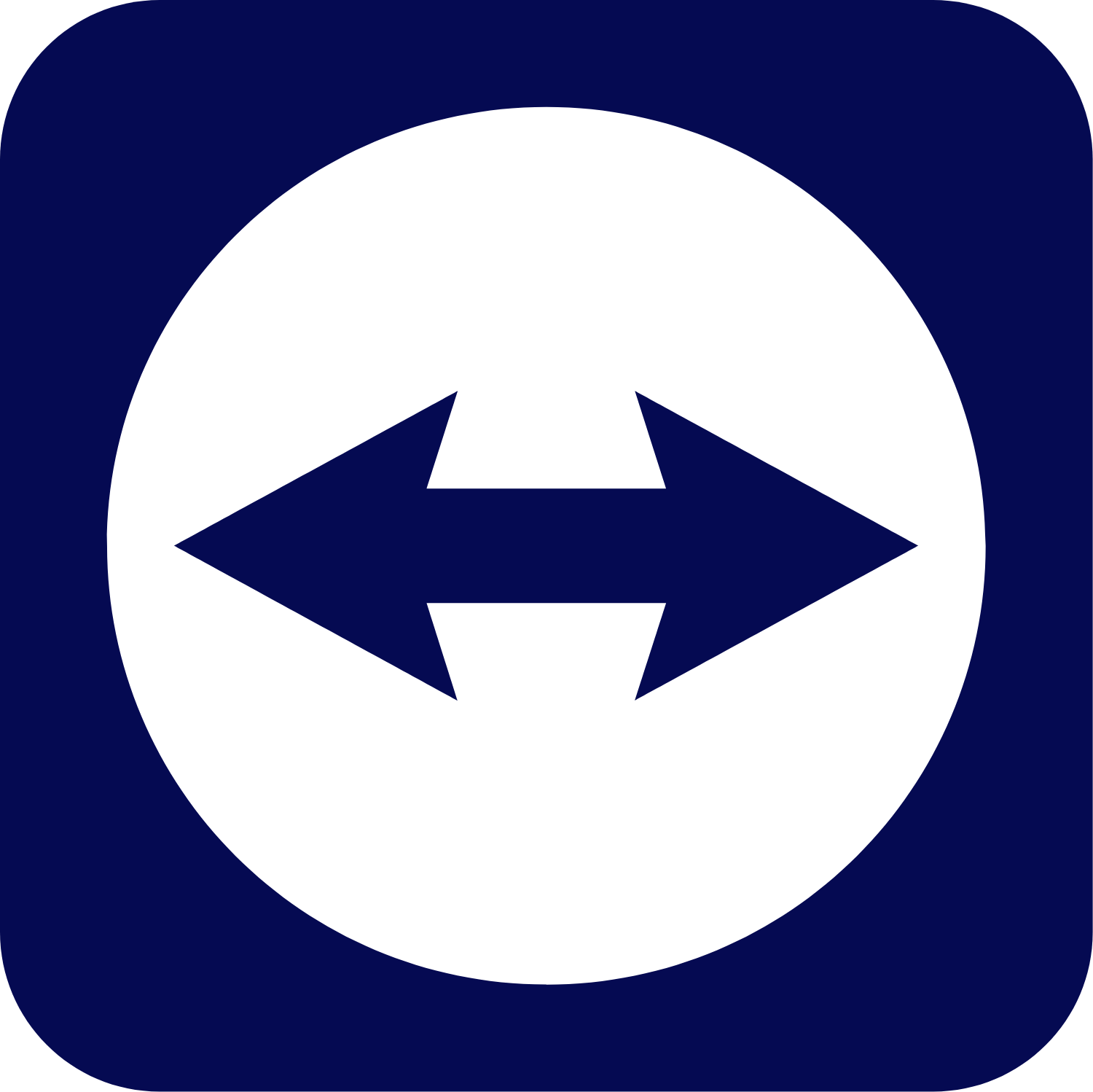Österreich: Bundesheer verlässt Microsoft komplett

Das österreichische Militär hat diese Woche einen radikalen Schritt vollzogen: 16.000 Arbeitsplätze wurden vollständig von Microsoft Office auf die Open-Source-Alternative LibreOffice umgestellt. Digitale Souveränität statt Kostenersparnis war das Hauptmotiv für einen der größten europäischen Open-Source-Umstieg im Behördenbereich der letzten Jahre.
Die meherjährige Migration macht Wien zum Vorbild für technologische Unabhängigkeit. Während andere EU-Staaten noch über Alternativen zu US-amerikanischen Software-Giganten diskutieren, haben die österreichischen Streitkräfte Fakten geschaffen.
Sicherheitsbedenken als Haupttriebfeder
Michael Hillebrand von der Direktion 6 – IKT und Cyber des Bundesheeres bringt die Kernmotivation auf den Punkt: "Es war sehr wichtig zu zeigen, dass wir dies primär zur Stärkung unserer digitalen Souveränität tun." Die Entscheidung fiel bereits 2020, als Microsoft seine Zukunftsstrategie zunehmend in Richtung Cloud-Lösungen ausrichtete.
Für das Militär war das ein No-Go: Sensitive Daten sollten ausschließlich im eigenen Haus verarbeitet werden. Die Vorstellung, dass militärische Informationen auf externen Servern landen könnten, widersprach fundamental den Sicherheitsanforderungen der Streitkräfte.
Diese Haltung fügt sich in Österreichs nationale Digital-Strategie ein, die seit 2020 Open-Source-Software als kritischen Baustein für eine resiliente und souveräne digitale Transformation positioniert.
Anzeige: Passend zum Thema digitale Souveränität und Open Source: Möchten Sie privat eine freie Alternative unverbindlich ausprobieren? Das kostenlose Linux-Startpaket liefert eine Ubuntu-Vollversion samt Schritt-für-Schritt-Anleitung für die risikofreie Parallelinstallation neben Windows – ohne Lizenzkosten, ohne Datenverlust. Ideal, um mehr Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit zu testen – gerade auch auf älteren PCs. Jetzt kostenloses Linux-Startpaket sichern
Fünfjähriger Marathon statt Hauruck-Aktion
Der Umstieg war alles andere als überhastet. Bereits 2020 begannen Planungen und Evaluierung von Microsoft-Alternativen, 2021 fiel die offizielle Entscheidung für LibreOffice. Ein deutsches Softwareunternehmen gewann 2022 die öffentliche Ausschreibung für die technische Umsetzung.
Die größte Herausforderung: Legacy-Systeme, die tief mit Microsoft-spezifischen Lösungen wie Visual Basic for Applications (VBA) und Access-Datenbanken verwachsen waren. Pilotprogramme, umfassende Mitarbeiterschulungen und E-Learning-Module bereiteten das Personal auf die neue Software-Umgebung vor.
Ein kleiner Kompromiss bleibt: Für spezialisierte Anwendungen, die noch nicht vollständig migriert werden konnten, gibt es weiterhin genehmigungspflichtigen Zugang zu Microsoft Office.
Parlamentarischer Rückenwind
Das Bundesheer agiert nicht im luftleeren Raum. Im Juli 2023 verabschiedete das österreichische Parlament einstimmig eine Resolution zur Stärkung der digitalen Souveränität durch verstärkten Open-Source-Einsatz. Eine eigene Arbeitsgruppe im Chief Digital Officer Task Force unterstützt seit 2022 die OSS-Einführung in der Bundesverwaltung.
Auch die Stadt Wien setzt zunehmend auf quelloffene Lösungen – ein Trend, der das militärische Vorhaben in einen breiteren politischen Kontext einbettet.
Europäischer Präzedenzfall mit globaler Wirkung
Warum ist dieser Schritt so bemerkenswert? Transparenz ist der Schlüssel: Open-Source-Code kann vollständig auditiert werden, Hintertüren oder unerwünschte Funktionen sind ausgeschlossen. Das schafft Vertrauen, wo Sicherheit oberste Priorität hat.
Geplant sind weitere Anpassungen: Das Bundesheer will künftig taktische Militärsymbole direkt in LibreOffice-Dokumente integrieren können – eine hochspezialisierte Anforderung für militärische Planungen.
Ein charmanter Nebeneffekt der Open-Source-Philosophie: Viele vom Bundesheer entwickelte Verbesserungen fließen zurück in das globale LibreOffice-Projekt. Österreichische Steuerzahler finanzieren so nicht nur die eigene Verteidigung, sondern verbessern gleichzeitig Software für Millionen Nutzer weltweit.
Die erfolgreiche Großmigration dürfte anderen Regierungen und Sicherheitsorganisationen als Blaupause für den Weg zur digitalen Unabhängigkeit dienen. In Zeiten geopolitischer Spannungen zeigt Wien: Digitale Souveränität ist machbar – man muss sie nur wollen.