Lebensmittelpreise: Österreich schmiedet EU-Allianz gegen "Aufschlag"
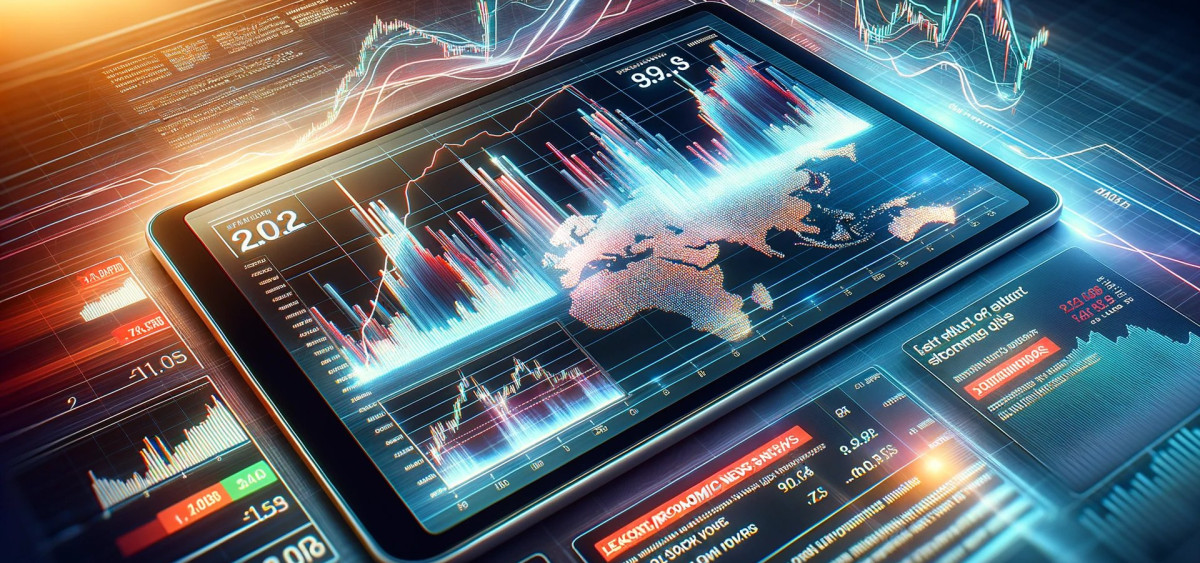
Österreich erhöht den Druck auf Brüssel. Eine Allianz aus acht EU-Staaten soll territoriale Lieferbeschränkungen stoppen, die identische Produkte in der Alpenrepublik teurer machen als in Nachbarländern. Gleichzeitig fordern deutsche Verbraucherschützer eine staatliche Preis-Beobachtungsstelle.
Die Politik steht vor einem Dilemma: Bürger entlasten, ohne den Markt zu verzerren. Denn Ökonomen warnen eindringlich vor direkten Eingriffen in die Preisgestaltung.
Deutsche Verbraucherschützer wollen Transparenz erzwingen
Lebensmittel werden nicht günstiger. Das Statistische Bundesamt meldet für August einen Preisanstieg von 2,5 Prozent – über der allgemeinen Inflationsrate von 2,2 Prozent.
"Viele Menschen fühlen sich mit den ständigen Preiserhöhungen im Stich gelassen", erklärt Ramona Pop vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Ihre Forderung: Eine Preisbeobachtungsstelle nach spanischem und französischem Vorbild soll unfaire Praktiken aufdecken.
Zusätzlich verlangt der vzbv:
* Klare Kennzeichnung von Mogelpackungen
* Temporäre Mehrwertsteuer-Aussetzung für Obst und Gemüse
* Gezielte Entlastungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen
Österreich mobilisiert gegen den "Preis-Aufschlag"
Wien kämpft gegen eine andere Ungerechtigkeit: Territoriale Lieferbeschränkungen erlauben internationalen Konzernen, Händlern vorzuschreiben, wo sie einkaufen dürfen. Das Ergebnis? Identische Produkte kosten in Österreich deutlich mehr.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat das Problem zur Chefsache erklärt. In einem Brief an die EU-Kommission fordert er einen raschen Gesetzesvorschlag gegen den "Österreich-Aufschlag".
Die Strategie zeigt erste Erfolge: Acht weitere EU-Staaten schlossen sich der österreichischen Initiative an. Gemeinsam erhöhen sie den Druck auf Brüssel.
Doch es gibt Widersprüche: Österreichische Beamte rieten in einer EU-Arbeitsgruppe im Juni noch zur Zurückhaltung bei neuen Regulierungen.
Schuldzuweisungen entlang der Lieferkette
Wer trägt die Verantwortung für hohe Preise? Die Antworten fallen je nach Position unterschiedlich aus.
Handel gegen Konzerne: Handelsverbände unterstützen Maßnahmen gegen Lieferbeschränkungen. Sie sehen steigende Einkaufspreise der Konzerne als Hauptproblem.
Landwirte gegen Supermarkt-Riesen: Deutsche Bauernverbände beklagen die Marktmacht der großen Ketten. Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe teilen sich über 85 Prozent des Marktes. Diese Konzentration erschwere Preisverhandlungen auf Augenhöhe.
Das Ergebnis? Nur ein Bruchteil der Supermarkt-Preise erreicht die Erzeuger.
Ökonomen warnen vor Preisdeckeln
Die Versuchung staatlicher Eingriffe wächst. Volksparteien fordern bereits Preisdeckel für Grundnahrungsmittel. Doch Experten schlagen Alarm.
Ökonomen des Instituts für Höhere Studien (IHS) und des WIFO sehen massive Risiken:
* Marktverzerrungen
* Sinkende Produktqualität
* Versorgungsengpässe
Ungarn lieferte bereits ein warnendes Beispiel – dort führten Preisdeckel zu leeren Regalen.
Die Europäische Zentralbank beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Lebensmittelinflation blockiert das Absinken der Gesamtrate. Klimawandel verstärkt den Preisdruck durch gestörte Lieferketten.
EU-Kommission unter Zeitdruck
Österreichs Allianz setzt Brüssel unter Zugzwang. Die aktuelle Binnenmarktstrategie plant "Werkzeuge" gegen territoriale Lieferbeschränkungen – erst bis Ende 2026.
Zu spät für frustrierte Verbraucher? Die kommenden Monate werden zeigen, ob die EU-Kommission den Zeitplan beschleunigt.
Deutschland steht vor ähnlichen Entscheidungen. Die Debatte um eine Preisbeobachtungsstelle dürfte anhalten. Gezielte Hilfen und Transparenz oder direkte Preisregulierung – die Regierungen müssen bald wählen.










