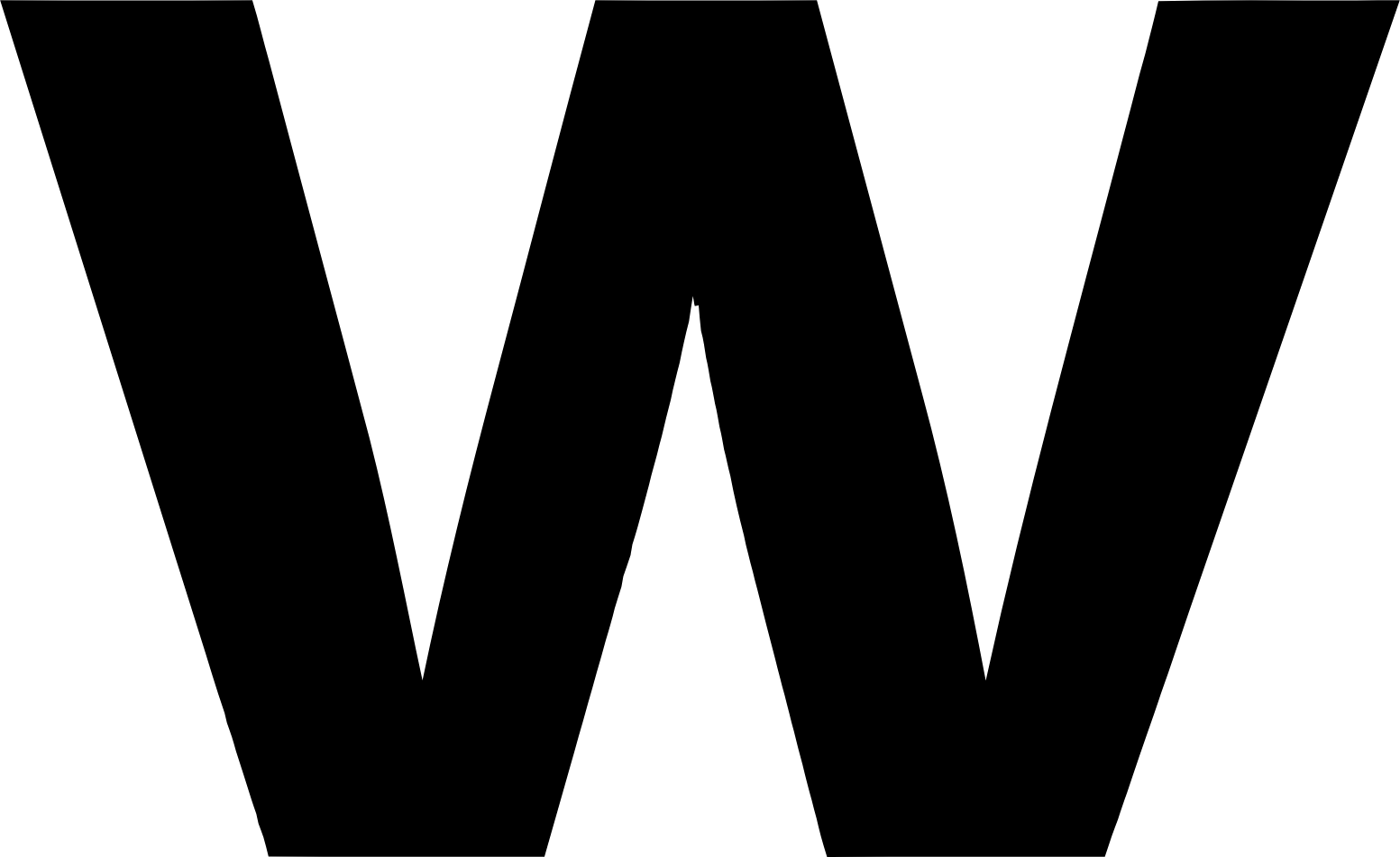Deutschland startet Wasserstoff-Offensive mit Milliardenförderung

Das Bundeskabinett beschloss gestern das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz. Damit sollen Genehmigungsverfahren drastisch verkürzt und die Energiewende vorangetrieben werden.
Die Initiative umfasst milliardenschwere Förderprogramme und soll Deutschland als Leitanbieter für Wasserstofftechnologien etablieren. Die Maßnahme ist eine direkte Antwort auf die Klimaziele und die Notwendigkeit, die Energieversorgung zu diversifizieren.
Ziele verdoppelt: Zehn Gigawatt bis 2030
Die fortgeschriebene Nationale Wasserstoffstrategie aus Juli 2023 verdoppelte bereits die Ambitionen. Statt fünf sollen bis 2030 mindestens zehn Gigawatt Elektrolysekapazität für grünen Wasserstoff entstehen.
Bund und Länder mobilisieren dafür erhebliche Mittel über die "Wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse" (IPCEI). Die EU-Kommission genehmigte 24 deutsche Projekte mit 4,6 Milliarden Euro staatlicher Förderung. Unternehmen steuern weitere 3,4 Milliarden Euro bei.
Das Geld fließt direkt in Elektrolyseure, Speicher und Pipeline-Infrastruktur. Ohne diese Grundlage kann die Wasserstoffwirtschaft nicht funktionieren.
Europäische Wasserstoffbank zahlt eine Milliarde
Die Europäische Wasserstoffbank schließt die Lücke zwischen Produktionskosten und Marktpreis. Bei der zweiten Auktionsrunde im Mai 2025 erhielten 15 Projekte europaweit fast eine Milliarde Euro Zuschuss - zwei davon aus Deutschland.
Diese Projekte produzieren über zehn Jahre 2,2 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff und vermeiden 15 Millionen Tonnen CO₂. Ende 2025 folgt die dritte Auktionsrunde mit bis zu einer Milliarde Euro Budget.
Der EU-Innovationsfonds unterstützt zusätzlich Großprojekte im Wasserstoffsektor. Europa meint es ernst mit der Wasserstoffwende.
Genehmigungen werden zum Turbo-Verfahren
Lange Genehmigungsverfahren bremsten bisher jeden Fortschritt aus. Das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz erklärt Wasserstoff-Anlagen und -Leitungen zu Projekten im "überragenden öffentlichen Interesse".
Dieser Status beschleunigt Planungs- und Zulassungsentscheidungen erheblich. Das Gesetz erfasst die komplette Lieferkette:
- Elektrolyseure an Land und auf See
- Importterminals
- Pipeline-Netz
Bis 2027/2028 soll ein Wasserstoff-Startnetz mit über 1.800 Kilometern entstehen. Es wird bis 2032 zum Kernnetz ausgebaut und verbindet alle wichtigen Produktions- und Verbrauchszentren.
Deutschland muss 70 Prozent importieren
Die Investitionen haben auch geopolitische Gründe. Deutschland will die Abhängigkeit von einzelnen Ländern beenden und diversifizierte Energiepartnerschaften aufbauen.
Experten rechnen damit, dass Deutschland 50 bis 70 Prozent seines Wasserstoffbedarfs importieren muss. Die Importstrategie soll klare Signale an Partnerländer senden und hohe Standards etablieren.
Für die deutsche Industrie ist grüner Wasserstoff überlebenswichtig. Stahl- und Chemieindustrie brauchen ihn zur Dekarbonisierung. Ohne Wasserstoff sind die Klimaziele bis 2045 nicht erreichbar.
Die nächsten zwei Jahre entscheiden alles
Der Rahmen steht - jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz durchläuft das parlamentarische Verfahren, während IPCEI-Projekte in die Realisierung gehen.
Die Industrie wartet auf Förderbescheide für finale Investitionsentscheidungen. Gleichzeitig entstehen internationale Lieferketten und die Technologie wird skaliert.
Die nächste Wasserstoffbank-Auktion Ende 2025 wird zeigen, wie sich Investitionsklima und Preise entwickeln. Der Erfolg der Energiewende hängt davon ab, wie schnell diese Pläne Realität werden.