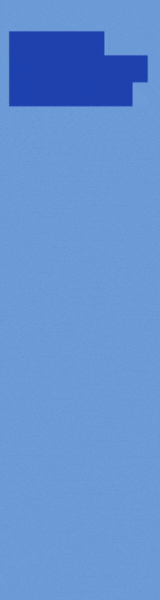Holzindustrie Österreichs mit Rückgang in schwierigem Umfeld
23.05.2024 | 10:29
Schwache Baukonjunktur hinterlässt Spuren, Fokus Fachkräftesicherung, Marktumfeld bleibt angespannt, Bessere Rahmenbedingungen notwendig
„Die Holzindustrie hat sich im Jahr 2023 in einem schwierigen Umfeld verhältnismäßig gut gehalten. Die anhaltende Schwäche der Baukonjunktur hinterlässt Spuren auch in unserer Branche.
“ Dieses Fazit zieht Mag. Herbert Jöbstl, Obmann des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs. Die 1289 Mitgliedsunternehmen des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs haben im Jahr 2023 Waren im Wert von 9,8 Milliarden Euro abgesetzt, das ist ein Rückgang von 18,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wir sehen den Trend einer rückläufigen Produktion in ganz Europa und weltweit. In Österreich ist die Holzindustrie angesichts der Rezession immer noch gut aufgestellt
,“ betont Jöbstl. Aber auch die Exportzahlen sind niedriger. Der Außenhandelsüberschuss betrug 2023 1,5 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang von 14 Prozent. „Auf den internationalen Märkten konnten sich unsere Betriebe auf hohem Niveau behaupten. Mit den richtigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, wird die Holzindustrie zukünftig erfolgreich bleiben“, hebt Jöbstl hervor.
Sicherung der Arbeitsplätze
Trotz der schwierigen Geschäftslage ist die Anzahl der Beschäftigten in der Holzindustrie weitgehend stabil. „Unsere Unternehmen vermeiden bisher einen umfangreichen Personalabbau“, betont Dr. Erlfried Taurer, Obmann-Stv. des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs. Im Jahr 2023 hatte die Holzindustrie rund 27.400 Beschäftigte, gegenüber dem Vorjahr sind das circa 720 Stellen weniger. Die Anzahl der Auszubildenden in den Betrieben ist von 819 in 2022 auf 826 im Jahr 2023 gestiegen. „Unsere Unternehmen sind auch in schweren Zeiten ein zuverlässiger Arbeitgeber. Im aktuellen Umfeld verzichten unsere Betriebe auf Gewinne, um die gut ausgebildeten Fachkräfte möglichst zu halten. Niemand baut ohne akute Not Stellen ab. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen wird jede ausgebildete Fachkraft gebraucht. Aber das funktioniert nicht dauerhaft. Unsere Mitglieder müssen bald wieder Geld verdienen und ihre Kapazitäten effizient auslasten
“, warnt Taurer.
Marktumfeld bleibt angespannt
Angesichts der andauernd schwachen Baukonjunktur plädiert der Fachverband der Holzindustrie für weitere Impulse, um die Auftragslage am Bau zu beleben. „Wir gehen davon aus, dass die Bauaktivitäten kurzfristig nicht zunehmen werden. Die Baugenehmigungen sind weiterhin rückläufig. Projekte, die jetzt nicht finanziert und genehmigt werden, werden später nicht gebaut“, sagt Dr. Andreas Ludwig, Obmann-Stv. des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs. Das jüngste Wohnbaupaket der Bundesregierung wird von den Interessenvertretern der Holzindustrie begrüßt. „Die Bundesregierung setzt mit dem Wohnbaupaket einen Schritt in die richtige Richtung. Bis tatsächlich Aufträge bei unseren Unternehmen ankommen, sind jedoch Übergangsmaßnahmen wie Stundungen und Ratenzahlungen für Forderungen des Finanzamts und der Sozialversicherungsträger nötig
“, fordert Ludwig. Sollten die bisher verabschiedeten Maßnahmen nicht ausreichen, seien weitere Impulse notwendig, zum Beispiel die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für Baudienstleistungen und -materialien. Auch die Verordnung für nachhaltige Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien (KIM-VO) kann angesichts der hohen Zinsen und stagnierender Immobilienpreise ausgesetzt werden, um den Zugang zu privaten Baufinanzierungen nicht zusätzlich einzuschränken. „Wenn die schwache Baukonjunktur noch lange anhält, werden wir Fachkräfte und Produktionskapazitäten dauerhaft verlieren. Sollte die Nachfrage später wieder anziehen, ohne dass ausreichende Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen, drohen erneut Lieferengpässe und steigende Preise für Baumaterialien“, warnt Ludwig und fordert: „Wir drängen daher weiterhin auf antizyklische Investitionsanreize, um die heimische Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu erhalten sowie den benötigten Wohnraum zu schaffen.
“
Politische Rahmenbedingungen notwendig
Über Wald und Holz wurde in der bald endenden Legislaturperiode des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit dem Green Deal häufig und kontrovers debattiert. „Vom neu gewählten EU Parlament und von der neuen EU Kommission erwarten wir einen Green Deal mit der Wertschöpfungskette Holz und nicht über unsere Köpfe hinweg“, fordert Herbert Jöbstl. Der Ansatz, die Bioökonomie zu stärken und die Holzverwendung auszuweiten, trifft in der Holzindustrie auf Zustimmung. Jedoch braucht es dafür auch den Rohstoff aus dem Wald. „Wir fordern ein klares Bekenntnis der Europäischen Union und der Regierungen der Mitgliedstaaten zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Es gibt keinen Holzbau ohne Holzernte. Alle bisherigen Green-Deal-Beschlüsse sollten überprüft und korrigiert werden, falls sie die Nutzung der nachwachsenden und nachhaltigen Ressource Holz unverhältnismäßig einschränken. Wir brauchen einen Green Deal, der eine zuverlässige und wirtschaftliche Rohstoffverfügbarkeit garantiert
“, betont Jöbstl.
Eine der größten Belastungen für die Holzindustrie infolge europäischer Gesetzgebung ist die EU Entwaldungsverordnung, kurz EUDR. „Selbstverständlich gegrüßt die Holzindustrie das Ziel der EUDR, die globale Entwaldung zu stoppen. Das grundlegende Problem der EUDR ist, dass sie gemessen am Bürokratieaufwand keinen Mehrwert bringt“, betont Jöbstl und erläutert: „Die EUDR gilt nicht nur für den Import in die EU, sondern zusätzlich für Herstellung und Handel innerhalb der EU. Die Entwaldung umfangreicher Flächen findet auf anderen Kontinenten statt, nicht in Österreich oder Europa. Dennoch müssen unsere Mitglieder nachweisen, dass von ihnen verarbeitetes Holz nicht durch Entwaldung in den Markt gekommen ist. Dabei versorgen sich unsere Betriebe hauptsächlich aus Österreich und angrenzenden Regionen unserer Nachbarländer.“ Obwohl die EUDR ab Jänner 2025 anzuwenden ist, sind noch viele Fragen der Umsetzung offen. Daher fordert die Holzindustrie eine längere Umsetzungsfrist und dass die EU Kommission für die weitere Umsetzung die Prozesse in der Lieferkette und die betriebliche Praxis berücksichtigt. „Die EUDR muss nach den Wahlen zum Europäischen Parlament grundlegend überarbeitet und an die praktischen Anforderungen angepasst werden. Länder mit nachweislich stabiler, zunehmender Waldfläche, nachhaltiger Waldbewirtschaftung und funktionierendem Gesetzesvollzug sind von den unnötigen bürokratischen Hürden auszunehmen
“, fordert Jöbstl.
Die zunehmenden und immer komplexeren Vorgaben der Europäischen Union sind eine wachsende Belastung für die Wirtschaft. Zwischen 2019 und 2023 hat der europäische Gesetzgeber den Unternehmen insgesamt 850 neue Verpflichtungen auferlegt, was mehr als 5.000 Seiten an Rechtsvorschriften entspricht. „Die nächste EU Kommission muss den Fokus auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit lenken. Es braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen politischen Ambitionen und wirtschaftlicher Realität“, sagt Erlfried Taurer. Bei jeder künftigen Rechtsetzung sollte eine Folgenabschätzung erfolgen, die potenzielle wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen gleichberechtigt prüft sowie die Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU berücksichtigt. „Für die Herausforderungen der Zukunft und die Transformation der Wirtschaft brauchen die Unternehmen Freiheit und Flexibilität statt Verengung und ständig neue Vorschriften. 25 Prozent weniger Bürokratiekosten bis 2029 sind ein guter Deal für Europas Zukunft
,“ betont Taurer.
Wirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Europa
Die wirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft wird meist erheblich unterschätzt. „Ähnlich wie Tourismus oder Sport – ist auch die Forst- und Holzwirtschaft eine Querschnittsmaterie, deren ökonomischer Beitrag in der Statistik auf eine Vielzahl von Sektoren verteilt ist. Da das Wertschöpfungsnetzwerk Holz, welches nicht nur den Rohstoff, sondern auch die weiterverarbeiteten Produkte und relevante Dienstleistungen umfasst, komplex und weitläufig ist, braucht es eigene Verfahren, um den wirtschaftlichen Beitrag korrekt zu erfassen.
“ erklärt Dr. Anna Kleissner, Inhaberin der Econmove GmbH und Autorin der Studie Die ökonomische Bedeutung der europäischen Forst- und Holzwirtschaft im Sinne der Bioökonomie.
In 30 europäischen Staaten (EU27, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich) beträgt die totale Bruttowertschöpfung, diese umfasst alle direkten, indirekten und induzierten Effekte, die auf die europäische Forst- und Holzwirtschaft zurückzuführen sind, rund 1100 Milliarden (1,1 Billionen) Euro. Dies entspricht ungefähr der Wirtschaftsleistung Spaniens oder einem Anteil von 7,1 Prozent an der gesamten Wirtschaftsleistung dieser 30 Länder. Die Branche sichert europaweit in etwa 17,5 Millionen Arbeitsplätze. Dies entspricht circa der Einwohnerzahl der Niederlande. Mit jedem Arbeitsplatz in der Forst- und Holzwirtschaft werden weitere 1,2 Arbeitsplätze in anderen Sektoren geschaffen oder gesichert. 6 Prozent der Beschäftigten sind im Durchschnitt in den 30 europäischen Staaten unmittelbar oder mittelbar durch die Forst- und Holzwirtschaft beschäftigt. Die Studie steht auf www.holzindustrie.at zur Verfügung.