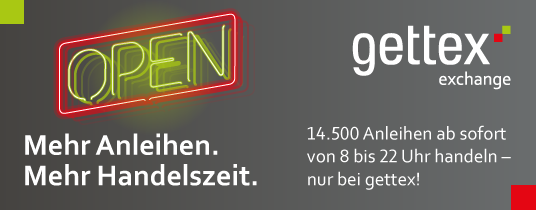Giorgia Meloni übernimmt die Führung in Italien (Henning Kirsch)
11.10.2022 | 13:04
Italien hat gewählt und die Gewinnerin heißt – Giorgia Meloni. Eine Politikerin mit neofaschistischen Wurzeln in der geistigen Verbundenheit zu Benito Mussolini. Das wirkt, knapp zwei Wochen danach, erstaunlich wenig bemerkenswert, denn schon kurz nach dem Wahlsieg ihres rechtspopulistischen Bündnisses der „Brüder Italiens – Fratelli d’Italia“ (FDI) am 25.09.2022 haben die Finanzmärkte den Rechtsruck an der politischen Spitze Italiens scheinbar gut verdaut.
Das könnte Sie auch interessieren
Aktien, Märkte, Branchen in Zahlen - die Top-Aktien Italiens
Gemessen an den globalen Krisen des russisch – ukrainischen Konfliktes oder der weltweiten Inflation sind die Wahlausgänge in europäischen Ländern vordergründig betrachtet, wenig spektakulär. Mit dem Wahlsieg rechter Parteien in Italien könnte jedoch ein längerfristiger Kurswechsel in der europäischen Union eingeleitet worden sein, der über die kommenden Jahre für die Einheit der europäischen Union zu einer massiven Belastungsprobe werden könnte.
Populistische Parteien gewinnen schon seit Jahren in den Ländern Europas an Bedeutung. Insbesondere in Politikgebieten, wo breite Mehrheiten erforderlich sind, können Populisten mit Blockadepolitik europäische Politik machen. Wir erleben dies bereits bei einzelnen Staaten der Eurozone, wo nationale Interessen einem europäischen Gemeinwohl gegenüber dominieren. Die Schuld daran ist nicht einzig in den Parteien an sich zu sehen.
Rechtspopulistische Tendenzen entstehen häufig aus Unzufriedenheit mit einer sogenannten regierenden „Elite“. Dabei geht es hier nicht darum, eine Elite abzuschaffen, sondern selbst zur Elite zu werden – und das im Namen der eigenen, als „zugehörig“ verorteten Bevölkerung, welche dadurch selbst in den Stand einer Elite erhoben wird und so zu einem manövrierbaren Instrument werden kann.
Wird also beispielsweise die Finanzpolitik der europäischen Union angefeindet und als elitäres Gebilde deklariert, bedeutet das keineswegs, dass eine im Sinne einer europäischen Gemeinschaft gestaltete, rechtspopulistisch geprägte Alternative gefunden werden will. Dadurch, dass dem Rechtspopulismus das Ausmachen von Schuldigen an einer Misere (…) kann ein Prozess, der zuvor angefeindet wurde, bei einem Wahlsieg zum eigenen Mittel erhoben werden.
Entscheidend ist dabei stets der nationale Blick, also zuerst das eigene Land und die eigenen Interessen. Diese Haltung liegt durchaus in der Geschichte der heutigen europäischen Union begründet, hat sie sich doch über Jahre als elitäre Reguliererin präsentiert, ohne wirkliche Volksnähe zu erzeugen. Dieses, als „elitär und bevormundend“ wahrgenommene Auftreten überdeckte die tatsächlichen Errungenschaften der europäischen Union und wurde so zu einem Nährboden rechtspopulistischer Strömungen in ganz Europa. Dadurch sind starke, nationale Strömungen in vielen europäischen Staaten wie Ungarn, Polen, Frankreich, Deutschland oder eben auch Italien entstanden, die mehr und mehr Einfluss auf die europäische Politik, insbesondere die Geldpolitik nehmen wollen.
Giorgia Meloni greift einen zentralen Punkt, nämlich die Senkung von Steuern, auf und ist dafür bereit, die ohnehin ausufernde Schuldenquote des Landes von 159,4 Prozent weiter anschwellen zu lassen. Und dies ohne Einschränkungen auf EU-Subventionen in Kauf nehmen zu wollen. Dieser Prozess könnte den Schuldenabbau des italienischen Staates zum Erliegen bringen.
Mehr als jedes andere Land der EU hat Italien mit ca. 66 Milliarden Euro für Subventionen und Steuererleichterungen investiert. Ende November sollen diese auslaufen, doch ist nun fraglich, ob dies geschehen wird. Auch steht die staatliche Rentenreform, die unter anderen eine Rückkehr zum Regelrentenalter von derzeit 64 Jahren auf 67 Jahre vorsieht, auf dem Prüfstand. Italienische Renten sind an die Inflationsentwicklung gebunden, was einen enormen Druck auf die Staatskassen ausübt.
Ob die zukünftige Regierung in Italien bereit ist, den von Mario Draghi zuvor eingeleiteten Prozess des Schuldenabbaus weiter fortzuführen, ist mit Blick auf das Versprechen teurer Wahlgeschenke ungewiss. So steht beispielsweise den Forderungen nach Abfedern der Inflation und den Folgen der Energiekrise kein sichtbares Finanzierungskonzept gegenüber. Käme es zu fiskalischen Geschenken – also einer staatlichen Förderung durch höhere Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur in einer Phase, die auf Rezession hindeutet, könnten die Finanzmärkte, insbesondere die Anleihenmärkte, zukünftig stark in Bewegung geraten und auf der Seite des Euro dessen Stabilität weiter und von innen heraus gefährden.
Unter einer Regierung von Giorgia Meloni ist zu befürchten, dass das Anschwellen der Staatsaugaben und eine weiter ausufernde Schuldenpolitik daher auf Kosten der Währungsstabilität der Eurozone gehen könnte. Grundsätzlich will die Europäische Union Wirtschaftsliberalismus in der Tradition der Neoliberalisten wie dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule der Nationalökonomie erreichen. Diese Politik verspricht freien Wettbewerb und dauerhaften Wohlstand bei gleichzeitiger, maßvoller Staatsstützung in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Soziales.
Durch die Verstärkung von Staatsverschuldung zur Stimulierung der eigenen Wirtschaft („Deficit Spending“) oder auch protektionistischer Schutzmechanismen wie Subventionen entstehen Verzerrungen der Wirtschaftsleistung, deren Kompensation auf internationale Zuschüsse wie zum Beispiel den für Italien mit 220 Milliarden dotierten Pandemie-Wiederaufbaufonds verlagert werden können.
Für Investoren würde dies eine Aufweichung der Stabilität der italienischen Bonität bedeuten können, in deren Folge die Ausfallwahrscheinlichkeit von Finanzierungsinstrumenten steigen könnte. Noch ist nicht absehbar, wo die neue italienische Regierung in ihrer Fiskal- und Wirtschaftspolitik konkret hinsteuern wird. Die Angst vor Prozessen, wie soeben beschrieben, ist aber spürbar gestiegen. Die Erwartung geht derzeit dahin, Italien könne die, an EU-Gelder gekoppelten Reformen zunächst fortsetzen.
Investoren sollten bei ihrer Laufzeitenplanung bei Staatsanleihen und Ländergewichtung italienische Titel kritisch betrachten und dem Risiko entsprechend angemessen agieren. Etliche Rentenfonds, die hochausschüttend sind und in den Euro Währungsraum für Staatsanleihen investieren, haben eine starken Fokus auf italienische Titel. Eine hohe Gewichtung könnte hier Gefahren mit sich bringen. S&P bewertet die Bonität des Staates Italien mit „BBB“, also noch Investment Grade mit stabilem Ausblick (Einschätzung 26. Juli 2022). Diese Bewertung besteht seit Oktober 2017.
Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
Aus dem Börse Express PDF vom 11.10. hier zum Download